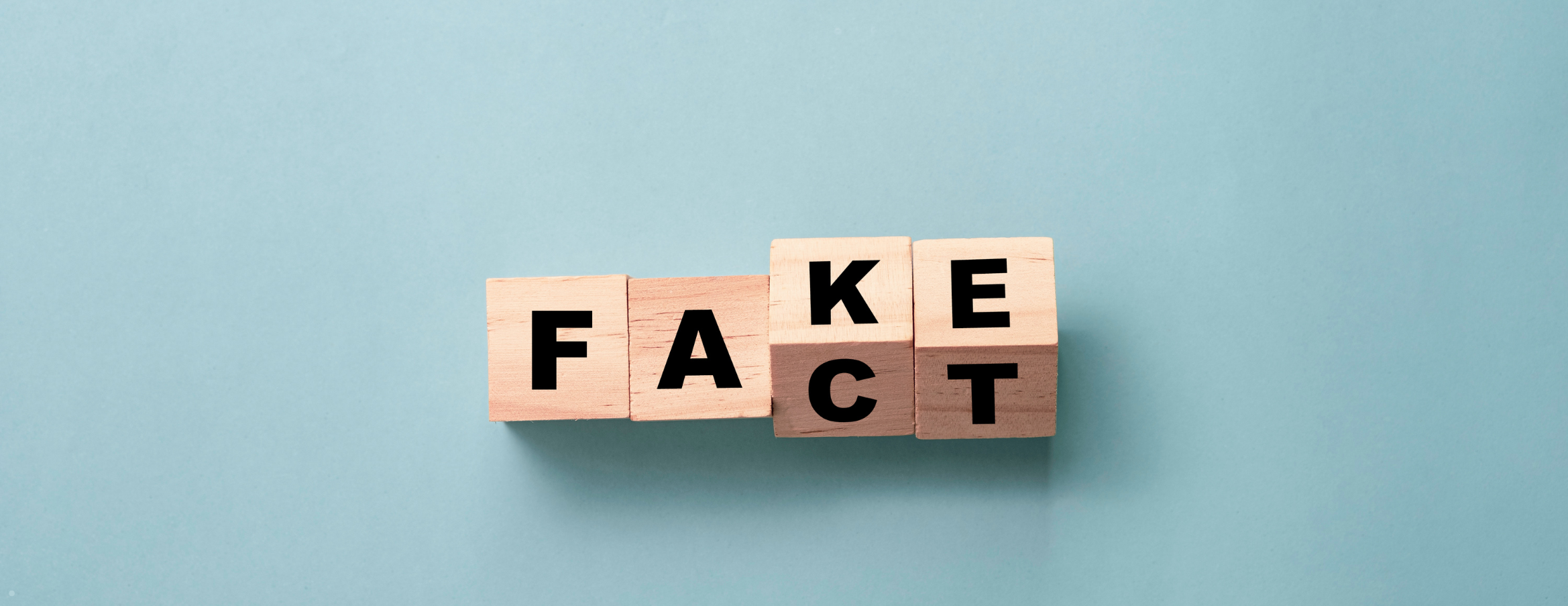
Fake News & PR: Wie Unternehmen mit Desinformation umgehen sollten
Unkategorisiert
Posted 13 Aug. 2025
In einer Zeit, in der sich Informationen rasant verbreiten und jeder zum Sender werden kann, sind Unternehmen verstärkt mit einem unsichtbaren Gegner konfrontiert: Fake News. Diese gezielte oder unbeabsichtigte Verbreitung falscher Informationen kann enorme Reputationsschäden verursachen. Für PR- und Kommunikationsverantwortliche bedeutet das: Reaktionsgeschwindigkeit, Strategie und Medienkompetenz sind wichtiger denn je.
Fake News sind nicht bloß ein politisches Phänomen, sondern treten zunehmend auch im Kontext von Unternehmenskommunikation in ganz unterschiedlichen Formen auf.
So kursierten etwa im Jahr 2023 in sozialen Netzwerken Gerüchte, ein großer deutscher Modekonzern stehe kurz vor der Insolvenz, obwohl das Unternehmen gerade erst positive Wachstumszahlen veröffentlicht hatte.
Auch manipulierte Kundenbewertungen oder Erfahrungsberichte sind ein typisches Beispiel: Ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln musste kurzfristig Umsatzeinbußen hinnehmen, nachdem gefälschte Negativrezensionen durch einen Wettbewerber veröffentlicht wurden.
Besonders perfide wirken sogenannte Fehlzitate, wenn Aussagen von Führungskräften bewusst aus dem Kontext gerissen werden. In einem bekannten Fall wurde der CEO eines Tech-Unternehmens fälschlich als Kritiker künstlicher Intelligenz dargestellt. Das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat verbreitete sich rasant, und das Unternehmen sah sich gezwungen, publik eine Statement zu veröffentlichen.
Auch gefälschte Dokumente und manipulierte Bilder können gezielt eingesetzt werden, um Unruhe zu stiften. Während eines Tarifkonflikts wurde etwa ein vermeintlich internes Memo über Massenkündigungen verbreitet –jedoch war das Dokument gefälscht, wie sich später herausstellte.
Hinzu kommt die gezielte digitale Stimmungsmache durch Bots oder sogenannte Trolle. Bei der Markteinführung eines neuen E-Autos wurde beispielsweise der offizielle Hashtag der Launch-Kampagne durch automatisierte Accounts genutzt und anonymisiert vermeintliche Nutzererfahrungen, Falschmeldungen und inszenierte Pannenbilder verbreitet.
Das Ziel solcher Aktionen: Verunsicherung, Misstrauen und letztlich ein beschädigtes Markenimage.
Die Auswirkungen reichen von kurzfristigem Vertrauensverlust bis hin zu langfristigen Umsatzeinbußen, wenn potenzielle Kunden oder Investoren durch Desinformation abgeschreckt werden. Ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen verlor beispielsweise innerhalb von 48 Stunden über 15 % an Marktwert, nachdem ein gefälschtes Medieninterview über angebliche Studienmanipulationen öffentlich wurde.
Zudem wird auch von Behörden oder NGOs zunehmend erwartet, dass Unternehmen zu gesellschaftlichen Entwicklungen Stellung nehmen – Schweigen kann in Zeiten digitaler Desinformation als Zustimmung gewertet werden.
Eine wirksame Reaktion auf Desinformation beginnt mit der richtigen Strategie – und diese setzt auf Prävention, schnelle Reaktion und Glaubwürdigkeit. Der erste Schritt ist eine frühe Erkennung durch aktives Monitoring. Effektives Social Listening bildet hierbei das Fundament, um aufkommende Falschinformationen rechtzeitig zu identifizieren. Ein eindrucksvolles Beispiel lieferte die Lufthansa Group im Jahr 2022: Innerhalb von nur 30 Minuten entlarvte das Unternehmen ein virales Video, das angeblich aktuelle Flugausfälle zeigte – tatsächlich stammten die Aufnahmen aus einem völlig anderen Zusammenhang. Durch das schnelle Eingreifen konnte die Fehlinformation entschärft werden, bevor sie sich weiter ausbreitete.
Darauf aufbauend spielt die faktenbasierte Gegendarstellung eine entscheidende Rolle. Unternehmen, die transparent und belegt kommunizieren, schaffen Glaubwürdigkeit, wenn sie auf konkrete Daten und öffentlich zugängliche Quellen setzen. Als ein großer Energieversorger beschuldigt wurde, illegal in Naturschutzgebieten zu bohren, reagierte das Unternehmen mit der Veröffentlichung von Satellitenbildern, Verlinkungen zu Umweltgutachten sowie einem öffentlich einsehbaren FAQ auf der Startseite. Diese faktenbasierte Aufklärung fand breite Resonanz und wurde von mehr als 30 Medien aufgegriffen.
Neben den eigenen Kanälen ist es wichtig, vertrauenswürdige Multiplikatoren wie Fachjournalisten oder Influencer einzubinden. Ein großer Online-Händler zeigte dies beispielhaft, als er inmitten eines Shitstorms wegen angeblicher Datenlecks gezielt Tech-Influencer, Blogger und renommierte IT-Fachmedien ansprach. Durch transparente Einblicke in die Sicherheitsarchitektur und offene Q&A-Sessions wurde das Vertrauen zurückgewonnen und eine Eskalation abgewendet.
Doch der wirksamste Schutz gegen Fake News ist oft die proaktive Kommunikation. Wer kontinuierlich verständlich und nahbar kommuniziert, reduziert die Angriffsfläche für Desinformation. Die Deutsche Bahn zeigt dies mit ihrer öffentlich zugänglichen Faktencheck-Seite, auf der regelmäßig falsche Behauptungen etwa zu Fahrpreisen, Großbaustellen oder politischen Forderungen sachlich widerlegt werden. Dieses Format dient nicht nur der Korrektur, sondern auch der aktiven Vertrauensbildung.
Nicht zuletzt darf die interne Kommunikation nicht vernachlässigt werden. Mitarbeitende sind wichtige Multiplikatoren – in ihrer beruflichen wie privaten Kommunikation. Während der Corona-Pandemie setzte ein Chemieunternehmen auf wöchentliche „Myth-Busting“-Newsletter, um verbreiteten Gerüchten über Impfpflichten oder angebliche Kündigungswellen entgegenzuwirken. So wurde nicht nur für Klarheit gesorgt, sondern auch das Vertrauen in die Unternehmensführung gestärkt.
Bei besonders rufschädigenden Falschmeldungen kann der Rechtsweg sinnvoll sein. So gelang es dem Outdoor-Ausrüster Vaude 2024, eine Unterlassungsklage gegen eine Plattform durchzusetzen, die unter ihrem Logo minderwertige Ware verkaufte. Dabei gilt: Der Gang vor Gericht sollte stets gut abgewogen werden, um keine zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Desinformation zu lenken.
Fake News lassen sich nie vollständig verhindern, doch Unternehmen können viel dafür tun, um ihre Wirkung gezielt abzuschwächen. Entscheidend ist eine Kommunikationskultur, die auf Resilienz, Vorbereitung und Haltung basiert. Dazu gehören vorausschauende Krisenpläne, die nicht erst im Ernstfall aufgesetzt werden, sondern regelmäßig aktualisiert werden und auch einintern geschultes Team umfassen, um im Krisenfall schnell reagieren zu können.
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist der langfristige Vertrauensaufbau durch konsistente Öffentlichkeitsarbeit. Unternehmen, die regelmäßig mit relevanten Inhalten, verlässlichen Fakten und glaubwürdigen Stimmen sichtbar sind, haben im Ernstfall die stärkere Ausgangsposition.
Einige Vorreiter gehen noch einen Schritt weiter: So haben beispielsweise SAP und Bosch interne Taskforces für Reputationsmanagement etabliert, die regelmäßig Desinformations-Szenarien durchspielen – vergleichbar mit IT-Notfallübungen. Diese Teams sind darauf vorbereitet, im Fall einer viralen Falschmeldung sofort zu reagieren und alle nötigen Maßnahmen in Gang zu setzen. Sie zeigen: Wer vorbereitet ist, reagiert nicht nur schneller,sondern auch souveräner.

Junior Marketing Consultant bei HBI Communication Helga Bailey GmbH
Jasmin Sobhanian unterstützt seit 2023 das Marketing-Team der HBI. Als Junior Marketing Consultant ist sie unter anderem für die Konzeptionierung von Marketingkampagnen, das Social-Media-Management sowie die Erstellung von fachbezogenen Beiträgen zuständig.
Foto:Canva